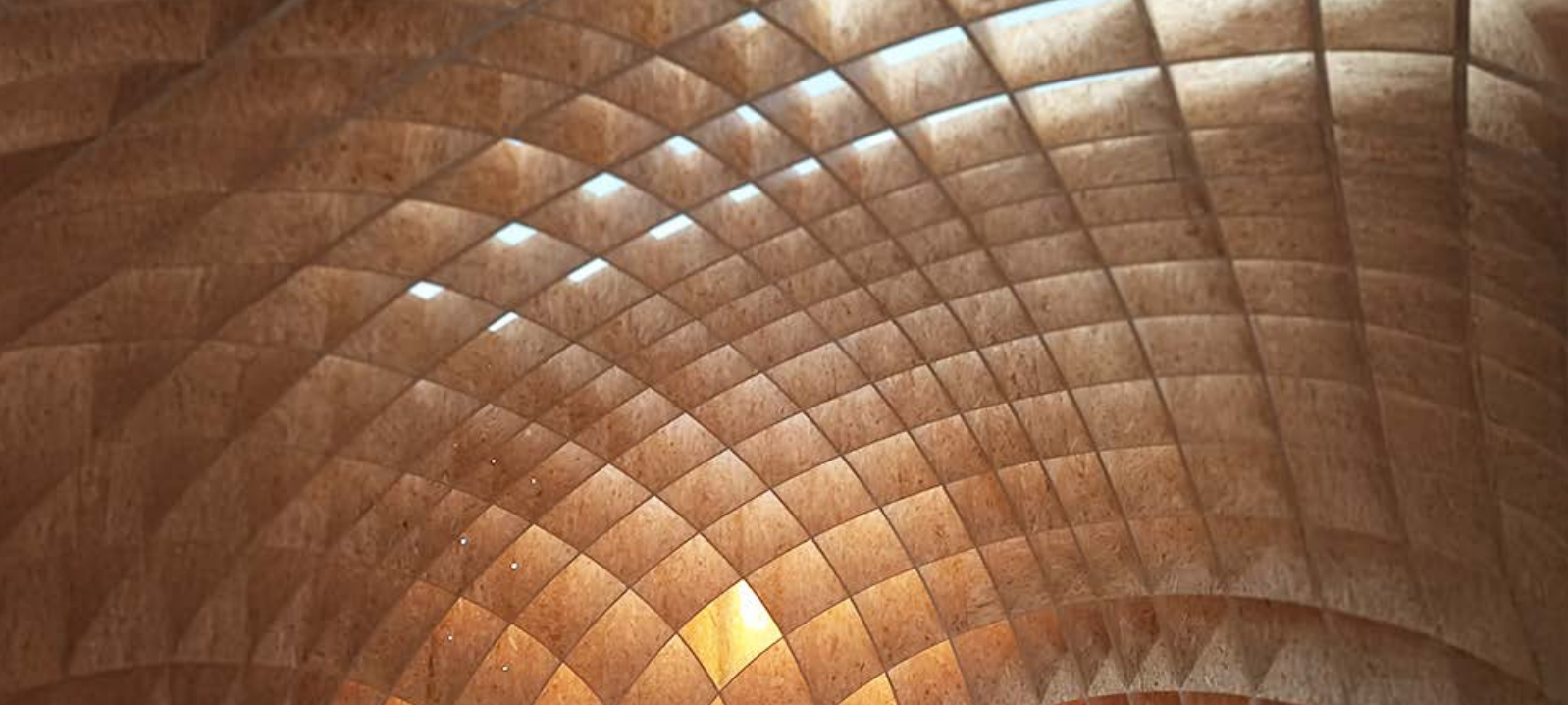Andrea Büttner, Guido Assmann, Rolf Steinhäuser und Peter Füssenich (v.l.) vor dem Siegerentwurf.
Zahlreich sind die unsäglichen antijüdischen Artefakte im Kölner Dom. Seit einigen Jahren setzt sich das Kölner Domkapitel mit der Frage nach einem angemessenen Umgang mit den Kunstwerken in der Kathedrale auseinander, die von erschreckender Judenfeindschaft zeugen. Nun endete ein vom Domkapitel 2023 ausgelobter „Internationaler Kunstwettbewerb Kölner Dom“. Dessen Ziel lautete, den Dom dauerhaft um ein Werk zu bereichern, „das die Frage zum Ausgangspunkt nimmt, wie sich das christlich-jüdische Verhältnis zeitgemäß und für die Zukunft inspirierend darstellen lässt“. Eingeladen waren 15 international renommierte Künstlerinnen und Künstler. Im März kürte das Preisgericht den Siegerentwurf: Einstimmig zur Umsetzung empfahl es den Entwurf „Ohne Titel“ von Andrea Büttner.
MAK nahm antijüdische Artefakte im Dom früh in den Blick
2017 habe die Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit die Arbeitsgruppe „Der Dom und die Juden“ initiiert, informierte Dr. Martin Bock, Leiter der Melanchthon-Akademie (MAK) Köln. „Zu ihr gehören Vertreter der Kölnischen Gesellschaft, des Domkapitels, der Dombauhütte, aber auch der Synagogen-Gemeinde Köln.“ Für den Evangelischen Kirchenverband Köln und Region (EKV) wurde Bock in diese Arbeitsgruppe berufen. Wohl auch deshalb, so der Theologe, „weil sich die MAK seit langer Zeit mit den antijüdischen Artefakten im Kölner Dom auseinandersetzt und sie problematisiert.“ 2002 bereits habe die MAK mit der Tagung „Gewalt im Kopf. Tod im Topf“ eine Kunstaktion verbunden. „Bei dieser ging der Aktionskünstler Wolfram Kastner vor dem Portal des Doms mit einem Schild um den Hals umher, auf dem stand: ´Judensau!´“, erinnert Bock. „Mit der Empörung und öffentlichen Aufmerksamkeit für die damals noch wenig bekannten antijüdischen Kunstwerke im Dom nahm die Auseinandersetzung ihren Anfang.“

Andrea Büttner mit ihrem Entwurf.
Das neue Bild soll oberhalb des Lochner-Altars „schweben“
Der Entwurf der in Berlin lebenden Künstlerin Andrea Büttner, Jahrgang 1972, sieht ein Wandgemälde an der Stirnwand der Marienkapelle des Domes vor. Es soll das Steinfundament des Thoraschreins aus der ehemaligen mittelalterlichen Synagoge Kölns in der Umgebung des heutigen Rathauses in originaler Größe und realistisch zeigen. Umgesetzt werden soll die Arbeit oberhalb des von Stefan Lochner um 1442 für die Ratskapelle geschaffenen und 1810 in den Dom überführten Altars der Stadtpatrone. „Die geplante Darstellung wirkt abstrakt und ist doch historisch und konkret“, informiert Büttner, die eine Professur für Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste München innehat.
Ersetzung eines Thoraschreins durch einen christlichen Altar
„Nach der Ausweisung der jüdischen Bevölkerung Kölns 1424 wurde die Synagoge zur Ratskapelle umgewidmet und der Thoraschrein auf dem Fundament durch Lochners Altar ersetzt“, sagt Büttner. Ihr geplantes Kunstwerk verbinde im Dialog mit dem Altar die Geschichte des jüdischen Quartiers mit der des Domes. Das ermögliche auf unmittelbare Weise, die Ersetzung eines Thoraschreins durch einen christlichen Altar und die Präsenz jüdischen Lebens in Köln zu erzählen. „Es stellen sich Fragen über historische Schichtungen und Überschreibungen, Fragen über Alt und Neu, Oben und Unten. All diese Motive sind historisch, theologisch und politisch relevant.“
Idee für ein neues Kunstwerk für den Dom

Rolf Steinhäuser, Abraham Lehrer, Dr. Jürgen Wilhelm und Peter Füssenich (v.l.).
Aus der Arbeitsgruppe „Der Dom und die Juden“ heraus sei es in den vergangenen Jahren zu einzelnen Veranstaltungen und auch Ausstellungen gekommen, die die verschiedenen Artefakte kommentiert, kontextualisiert und natürlich auf das Deutlichste kritisiert hätten, so der MAK-Leiter. „Immer wieder stand die Frage im Raum: Was kann es über diese Kontextualisierung hinaus an Möglichkeiten geben, das gegenwärtige Verhältnis von Juden und Christen in den Dom einzutragen? Am Rande einer Veranstaltung 2019 entstand dann die Idee, nach einem NEUEN Kunstwerk für den Dom Ausschau zu halten.“ Bock wurde – wiederum als Vertreter der evangelischen Kirche – in eine Projektgruppe berufen, die im Auftrag des Domkapitels diesen Gedanken eruierte.
Initiative für den Wettbewerb
Bock spricht von einer „historischen Sitzung im Sommer 2023“. Zu dieser hätten Abraham Lehrer und Bettina Levy, Vorstandsmitglieder der Synagogen-Gemeinde Köln und die jüdischen Vertretenden in der Projektgruppe, das Domkapitel in die Räume der Synagoge in der Roonstraße eingeladen. Bei dieser Begegnung, so Bock, „wurden die Weichen für die Initiierung des Internationalen Kunstwettbewerbes gestellt“. Und in diesem Rahmen habe man eine Jury benötigt, in der auch die theologische Kompetenz für den jüdisch-christlichen Dialog eine Rolle gespielt habe. In dieser Jury durfte Bock stellvertretendes Mitglied sein: „Ich konnte an allen Sitzungen auch mit vollem Rederecht teilnehmen. Ein aufregendes, für mein theologisches Leben einmaliges Projekt, für das ich sehr dankbar bin.“
Dompropst Assmann: „Ein ganz wichtiger Tag heute“
Zuletzt wurde die Entscheidung der Jury der Öffentlichkeit vorgestellt. Dompropst Msgr. Guido Assmann äußerte sich im Namen des Domkapitels, „dass wir alle wirklich froh sind, dass die Kölnische Gesellschaft mit dabei ist und von Anfang an gesagt hat, wir müssen etwas tun, und können wir nicht etwas gemeinsam tun?“ In seinen Dank schloss er auch die Synagogen-Gemeinde Köln ein, „die sich mit uns zusammen- und auseinandergesetzt hat“. Ebenso die christlich-jüdische Projektgruppe, die das Ganze mit vorangetrieben habe, sowie die Wettbewerbsteilnehmenden. Die Vorstellung des Siegerentwurfs bedeute nicht einen Abschluss. „Das Thema, das Verhältnis Juden-Christen/Christen-Juden, ist ein Dauerauftrag an uns, das immer wieder anzugehen. Ich bin froh, dass wir das mit einem Akzent heute deutlich machen können“, sagte Assmann. Das Domkapitel folge der Empfehlung der Jury und werde aufgrund eines einstimmigen Beschlusses dieses Kunstwerk gerne umsetzen lassen. Derzeit würden die denkmaltechnischen Möglichkeiten untersucht und der Zeit- und Kostenrahmen entwickelt.
Das Kunstwerk „,Ohne Titel‘ ist ein visueller Einschlag“
„Die Teilnehmenden des Wettbewerbs haben ganz unterschiedliche und sehr eindrückliche Konzepte für das neue Kunstwerk im Kölner Dom vorgelegt“, attestierte ihnen die Jury-Vorsitzende Prof. Andrea Wandel ein großes Engagement und eine sorgfältige und tiefgehende Auseinandersetzung mit dieser besonderen Thematik. „Das Kunstwerk ´Ohne Titel´ von Andrea Büttner ist ein visueller Einschlag“, zitierte die Architektin aus der Begründung des Preisgerichts. „Es fordert die Betrachtenden nicht nur visuell heraus, sondern auch intellektuell. Die Darstellung des schwebenden Steines bringt eine zum Nachdenken anregende Ambilavenz ins Bild. Andrea Büttners Kunstwerk stellt sich auf präzise Weise der Kontextualität des Ortes.“ Das Werk lege einerseits eine in der Stadtgeschichte ablesbare Missachtung der jüdischen Bevölkerung offen. Andererseits befördere es die Auseinandersetzung mit dem Dom als Bedeutung und Sinn stiftenden überzeitlichen Sakralraum. „Die Arbeit zeigt exemplarisch eine Möglichkeit auf, dem antijüdischen und antisemitischen Bilderbe in Kirchen zu begegnen und den christlichen-jüdischen Dialog im Wissen um die Verfehlungen in der Vergangenheit auf Augenhöhe zu führen.“
Erfüllt den Anspruch, Kunst zu sein und nicht eine Illustration
„Ich war sprachlos, als ich den Entwurf zum ersten Mal gesehen habe“, erinnerte Dr. Stefan Kraus. Der Leiter des Erzbischöflichen Kunstmuseums Kolumba hatte den Eindruck, „da kommt etwas auf uns zu, was tatsächlich den Anspruch erfüllt, Kunst zu sein und nicht eine Illustration oder eine Bebilderung von Vorgedachtem“. Gleichzeitig sei er intuitiv begeistert gewesen, „dass sich das erfüllt, was man im besten Falle hoffen kann: Dass wir ganz komplizierte Sachverhalte versuchen zu vermitteln, darzustellen, uns aber wünschen, dass etwas dabei rauskommt, dass mit der größten Einfachheit, mit der größten Präzision alles das mitnimmt, ohne unsere vorgedachten Erwartungen zu erfüllen, sondern mit dem Anspruch, den ich an Kunst prinzipiell hege, nämlich präzise Ambivalenz zu schaffen.“ Kraus sieht Büttner als eine Künstlerin, die sich souverän für jede Aufgabe das ideale Medium suche. Für eine ganz große Qualität des Werkes hält es Kraus, „dass es darauf angelegt ist, uns auch sprachlos zu machen und zu zeigen, dass die Kunst jenseits der Sprache Sinn stiften kann“.
Geschwisterlich begegnen
Büttner habe sich den wahrscheinlich bekanntesten Ort im Dom ausgesucht, meinte Weihbischof Rolf Steinhäuser. Die Marienkapelle erreiche durch die werktäglich aus ihr via TV im deutschen Sprachraum übertragene 8-Uhr-Messe eine Wahrnehmung wie kein anderer Ort im Dom, so der Domkapitular und Bischofsvikar für Ökumene und interreligiösen Dialog im Erzbistum Köln. „Hochspannend“ nannte er Büttners entschiedenen Wunsch nach diesem Platz. Büttners Kunstwerk wolle mitten in diesem lebendigen liturgischen Alltag die Verdeckung und Überformung jüdischer Spiritualität durch christliche Spiritualität aufgreifen. „Der Thoraschrein und das Altarbild ruhen auf dem gleichen Fundament, historisch gesehen, aber jetzt auch ganz praktisch“, stellte Steinhäuser fest. Das sei der Glaube an den einen Gott, der Israel erwählt habe. Der von ihm mit diesem Volk geschlossene Bund sei nie gekündigt worden. Zwar bestehe bis heute eine bleibende Differenz zwischen jüdischer und christlicher Glaubenslehre. Aber es sei wichtig, dass wir uns geschwisterlich begegneten und Anknüpfungspunkte hätten.
„Das ist das, was wir uns gewünscht haben“
„Der Blick zurück in das christlich-jüdische Verhältnis, die Beschreibung der Gegenwart und der Blick in die Zukunft. Das ist das, was wir uns gewünscht haben“, freute sich Abraham Lehrer über den Entwurf. Das Vorstandsmitglied der Synagogen-Gemeinde Köln sieht in „Ohne Titel“ ein Kunstobjekt, das möglichst alle drei Fragen und Bereiche auf einmal beantwortet. „Das Wandbild macht einen neuralgischen Punkt im jüdisch-christlichen Verhältnis sichtbar, zeigt eine offene Wunde in diesen Beziehungen und lässt den Altar der Stadtpatrone auch als Zeugnis beschämender christlicher Machtinteressen erkennen. Der Eingriff der Künstlerin spiegelt das jüdisch-christliche Verhältnis auf subtile Weise: Er reflektiert die Stadtgeschichte hinsichtlich des belasteten Verhältnisses und zeigt beispielhaft eine tiefe Verletzung.“ Der analytische Blick auf die ortsspezifische Geschichte weite sich in die aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen, so Lehrer. Er dankte der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, dass sie diesen gesamten Prozess vor vielen Jahren bereits in Bewegung gesetzt habe. Und er dankte dem Domkapitel, dass es diesen Prozess überhaupt und den Künstlern eine große Freiheit ermöglicht habe.
„Judentum und Christentum auf Augenhöhe im Kölner Dom“
„Wir sind außerordentlich zufrieden“, bewertete Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, den Entwurf. Das Werk „ist wirklich eine Sensation. Judentum und Christentum auf Augenhöhe im Kölner Dom. Dank und Anerkennung für diesen wirklich mutigen Schritt nach Jahrhunderten der Diffamierung und Ausgrenzung.“ Geradezu genial nannte er Büttners Einfall, „sozusagen das Lesepult der alten jüdischen Synagoge zusammen zu schließen mit dem Altar der Stadtpatrone, der eben jahrhundertelang“ in dieser zu einem christlichen Gotteshaus umgewandelten Synagoge gestanden habe. „Weil wir nach vorne gehen wollen, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden damit“, stellte er nochmals die hervorragende Zusammenarbeit heraus. Mit Büttners Kunstwerk werde ein Bogen zum jüdischen Köln und dem in der Entstehung begriffenen Jüdischen Museum im Archäologischen Quartier Köln, kurz MiQua, hergestellt. Ihr Werk sei sinnstiftend und werde für große Aufmerksamkeit sorgen, so Wilhelm.
Den Altar nicht mehr ohne dieses Bild sehen und denken können
„Der Dom ist unbestreitbar ein Gesamtkunstwerk, in dem sich künstlerische Aussagen von Menschen, Gesellschaften der jeweiligen Zeit versammeln“, stellte Dombaumeister Peter Füssenich fest. Es sei gut, dass der Dom ein weiteres modernes Kunstwerk erhalte, das Büttner als Teil unserer Generation hinzufüge. „Der Altar der Stadtpatrone ist in sich schon ein ganz ikonisches Werk.“ Mit ihrem Werk gewinne dieser ikonische Altar eine weitere ikonische Bildhaftigkeit. „Man wird den Altar nicht mehr ohne dieses Bild sehen und auch nicht mehr denken können.“ Es verweise in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft – auf unsere gemeinsamen Fundamente, und all das, was mit den Fragen verbunden sei, die das Kunstwerk an uns stelle. Bei der Prüfung der Denkmalverträglichkeit sei keiner der zuletzt vier Entwürfe beanstandet worden. Ganz im Gegenteil greife Büttners Arbeit „auf die Raumwirkung innerhalb der Marienkapelle und die Atmosphäre ein, und verändert sie zu einem ganz positiven neuen Gesamtbild“. Malerei auf Stein sei im Dom ganz klassisch vorhanden. So füge sich das Werk auch in der Technik ganz wunderbar in das Gotteshaus ein.
Bevor das Werk hoffentlich 2026 realisiert werden könne, müssten noch Vorkehrungen getroffen werden. Darunter die konservatorische Sicherung einer Wandmalerei aus dem Jahr 1260 hinter dem Altar. Füssenich sprach ein großes Lob und größten Dank an Rolf Lauer und Bernd Wacker aus. Beide hätten mit dem umfangreichen Symposium 2006 den „Stein ins Rollen gebracht“. Damals seien zum ersten Mal die gesamten antijüdischen Darstellungen und Artefakte im Dom aufgearbeitet worden.
Ein sehr wichtiges Projekt
Für Bock ist der Wettbewerb „ein sehr wichtiges Projekt gewesen, nicht zuletzt wegen der Einbindung der jüdischen und der politischen Akteure aus der christlich-jüdischen Gesellschaft in Köln“. Das Domkapitel habe beispielhaft gezeigt, „dass eine Kathedrale mit der judenfeindlichen Haltung christlicher Theologie ohne Scheuklappen umgehen kann. Und dass sie den ökumenischen Impuls der Theologie und Kirchen aufnehmen kann, um zu einem wirklich NEUEN Verhältnis von Judentum und Christentum zu kommen, das auf Augenhöhe und gegenseitigem Lernen beruht“, sagte Bock im Interview. „Es war und ist beispielhaft, dass durch Kunst christliche Bauwerke einen Diskurs mit ihrer eigenen Vergangenheit führen können, die es kritischen Menschen erlaubt, diese oft belastende Vergangenheit nicht nur als ´Kriminalgeschichte´ anzusehen, die erst von außen skandalisiert wird.“
Christliches Fundament durch die Thora Israels vorgegeben
Der Sieger-Entwurf ist laut Bock sehr deutlich und klar in seiner Überordnung des Steinfundamentes des Thoraschreines über den christlichen Altar der Stadtpatrone. „Dies ist eine historische und eine theologische Aussage: historisch, weil damit die Unsichtbarmachung jüdischen Lebens im Mittelalter als solche aufgedeckt und überformt wird; theologisch, weil klar gesagt wird, dass christlich-spirituelle Aussagen, als Gebete, Schriftlesungen, Lieder und Predigten, wie sie täglich am Altar der Stadtpatrone ausgesprochen werden, eines Fundamentes bedürfen, das wir als Christen nicht selbst haben, sondern dass uns durch die Thora Israels vorgegeben ist.“ Dies sei ein „Wahrheitsraum“, den das Christentum immer wieder sträflich unterlaufen habe, indem es sich selbst – wie mit der Ratskapelle – an die Stelle des Gottesvolkes Israel gesetzt habe.
Das Werk „Ohne Titel“ ist in keiner Weise harmlos
Andrea Büttners Kunstwerk habe keinen „Titel“, so Bock, sie lasse diese und andere Deutungen in ihr Bild einfließen, sei dafür eine Leerstelle. „Ohne Titel“ sei dabei in keiner Weise harmlos – das Werk habe diese besagte konstruktive Facette, aber sie könnte als eine Drohung gelesen werden: „Dieser Fundamentstein ist ‚wieder aufgetaucht‘. Wehe dem, der ihn erneut zu vergraben sucht. Dem oder der ‚fällt er auf den Kopf‘. Mit ihm ist also zu rechnen. Andere können den ‚schwebenden Stein‘ aber auch als Angebot zu einer weniger festgezurrten Verhältnisbestimmung zwischen Kirche und Judentum lesen, also eher als ein gemeinsames Herausgefordertsein und Geeint-Werden durch die großen Polarisierungen unserer Zeit“, stellte Bock fest.
Text und Fotos: Engelbert Broich
 Vor 20 Jahren unterzeichneten VertreterInnen aus Synagoge, Kirche und Moschee und der Stadt Köln im historischen Rathaus die Kölner Friedensverpflichtung. Hat diese Verpflichtung heute noch Bedeutung? Wo wird sie in der Kölner Region in die Tat umgesetzt? Kennen Sie Beispiele? Wir sammeln sie und möchten sie sichtbar machen. Lassen Sie es uns wissen und senden ihre Beispiele oder Kommentare an: schaper@melanchthon-akademie.de
Vor 20 Jahren unterzeichneten VertreterInnen aus Synagoge, Kirche und Moschee und der Stadt Köln im historischen Rathaus die Kölner Friedensverpflichtung. Hat diese Verpflichtung heute noch Bedeutung? Wo wird sie in der Kölner Region in die Tat umgesetzt? Kennen Sie Beispiele? Wir sammeln sie und möchten sie sichtbar machen. Lassen Sie es uns wissen und senden ihre Beispiele oder Kommentare an: schaper@melanchthon-akademie.de Wann haben sie das letzte Mal einen ‚fragenden Tango‘ gesungen?
Wann haben sie das letzte Mal einen ‚fragenden Tango‘ gesungen?
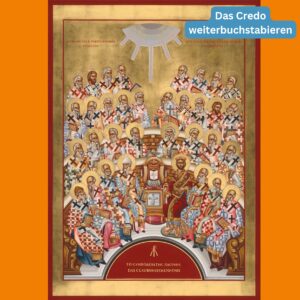







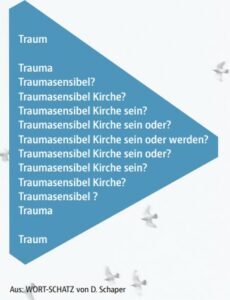 Fr., 28.03.2025, 10:00–16 Uhr
Fr., 28.03.2025, 10:00–16 Uhr LITERATURTIPP
LITERATURTIPP