Wer eine Philosophische Praxis gründet, weiß nicht, worauf er (oder sie!) sich einlässt. Dies galt schon 1998, als „Sinn auf Rädern“ startete. Und dies gilt auch heute noch. Wer eine Praxis gründet, muss wissen, mit welchem Angebot und welchen Fähigkeiten er am Markt (– ein Wort, das im Studium so gut wie nie vorkommt –) bestehen kann. Aber wie macht man das, ohne BWL-Studium, ohne Vorbereitung an der Uni? Und existiert für den Fall des Scheiterns ein „Plan B“? Diese Fragen, die auch heute noch von Absolvent:innen immer wieder gestellt werden, hat Markus Melchers sich auch gestellt. Seine Antwort darauf war die Veränderung des Konzepts von Philosophischer Praxis, das 1981 in Bergisch Gladbach vorgestellt wurde und bis heute Nachahmung findet.
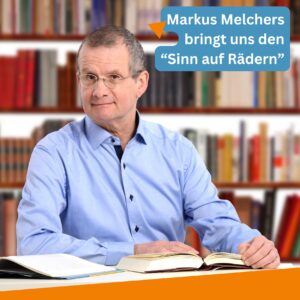
Fotorechte: M. Melchers
Philosophische Hausbesuche, die schon in der äußeren Form die Distanz zu jedweder Therapieform ausdrücken, das war ein grundlegender Gedanke. Im Rahmen ambulanter Philosophie zeigt sich bis heute, dass wer zu Gast ist oder als Gastgeber:in den Praktiker, die Praktikerin einlädt, sich auch als Gast verhält und sich als Gastgeber:in eben nicht als Klient:in versteht. Gleichberechtigung und das Ernstnehmen der Position der Gesprächspartner:innen sind bei diesen Zusammentreffen die entscheidenden Kriterien. Abstraktionsakrobatik, Unverständlichkeit und Schulbildung sind fehl am Platz. Denn im Zentrum der Arbeit des Praktikers und der Praktikerin steht dasjenige philosophische Wissen, das für die individuelle Lebensführung bedeutsam ist oder es werden kann. Die daraus folgende argumentierende Beratung beruht auf diesen Voraussetzungen.
Der andere grundlegende Gedanke betraf die Namensgebung der Praxis. Nach einigem Nachdenken stand „Sinn auf Rädern“ fest – es ist einprägsam und verweist auf die Mobilität des Angebots. Damit aber ist noch nicht – und dies ist ein anderer wichtiger Punkt – der Schritt in die Öffentlichkeit getan. Denn was nutzt ein Praxisschild an der Haustür, wenn niemand so recht weiß, was eine Philosophische Praxis ist? Wo ist der Ort, an dem sich das grundlegende Verständnis des Philosophischen Praktikers von ihm selbst regelmäßig mitteilen lässt? Wie lässt sich dieses Verständnis so formulieren, dass es nicht nur die Expert:innen erreicht?
Das Philosophische Café Bonn, das am 17.07.1998 zum ersten Mal durchgeführt wurde und bis heute monatlich stattfindet, war dieser Schritt in die Öffentlichkeit. Hier konnten und können die Teilnehmenden den Praktiker, Markus Melchers, regelmäßig erleben. Dies und die bald einsetzende Berichterstattung, die sich nur wünschen, aber nicht herbeiführen lässt, waren die Elemente, die zu einiger Bekanntheit führten.
Auch Buch- und Essayveröffentlichungen (bis heute mehr als 50 zu verschiedenen philosophischen, soziologischen, künstlerischen Themen) trugen dazu bei, wie auch Einladungen zu Tagungen und Workshops. Katholische und evangelische Träger der Erwachsenenbildung, Firmen, Verbände, Akademien, Universitäten und Privatpersonen engagieren „Sinn auf Rädern“ bis heute, sodass dessen jährliches Output bei bis zu 200 Veranstaltungen liegt. Markus Melchers gründete die Philosophische Bücherschau Bonn und als Mitherausgeber auch das Fachmagazin „Leidfaden. Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer“. Seit 2020 erscheint seine monatliche Kolumne „Sinn und Sein“ im Bonner Stadtmagazin „Schnüss“.
Philosophische Praxis ermöglicht es uns, die Philosophie aus der Theorie und dem akademischen Elfenbeinturm in unsere konkrete Lebenswelt zu integrieren und hier anwendbar zu machen. Sie eröffnet Raum für Reflexion, Selbstverantwortung und Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt. Durch ihre Anwendungsbezogenheit hilft sie dabei, existenzielle Fragen, ethische Dilemmata oder persönliche Krisen mit klarem Denken und begrifflicher Schärfe zu beleuchten. Dies stärkt die Urteilskraft, fördert innere Klarheit und hilft, einen bewussteren, sinnstiftenden Lebensstil zu entwickeln.
 Dafür steht auch Markus Melchers’ Angebot an der Melanchthon-Akademie: Seit einigen Jahren bietet er bereits und mit einiger Gegenliebe das Philosophische Café an der Akademie an, bei welchem die Gespräche, ohne den Umweg über eine bestimmte Theorie zu nehmen, sich direkt an die Menschen wenden, die auch die eigene Biografie zum Ausgangspunkt des Nachdenkens machen können. So können auch die verschiedenen Philosophien im Hinblick auf ihre Bedeutung für die eigene Lebensführung befragt werden. Eine philosophische Grundbildung ist dafür nicht notwendig, einzig die Freude am Nachdenken und gemeinsamen Sinnieren qualifiziert für die Teilnahme.
Dafür steht auch Markus Melchers’ Angebot an der Melanchthon-Akademie: Seit einigen Jahren bietet er bereits und mit einiger Gegenliebe das Philosophische Café an der Akademie an, bei welchem die Gespräche, ohne den Umweg über eine bestimmte Theorie zu nehmen, sich direkt an die Menschen wenden, die auch die eigene Biografie zum Ausgangspunkt des Nachdenkens machen können. So können auch die verschiedenen Philosophien im Hinblick auf ihre Bedeutung für die eigene Lebensführung befragt werden. Eine philosophische Grundbildung ist dafür nicht notwendig, einzig die Freude am Nachdenken und gemeinsamen Sinnieren qualifiziert für die Teilnahme.
Inzwischen gibt es auch weitere Angebote, die sich auf bestimmte Philosoph:innen beziehen und tiefer in die Textarbeit einsteigen. Nach ethischen und sozialphilosophischen Auseinandersetzungen mit Immanuel Kant, Eva Illouz und Hannah Arendt wird in diesem Semester Martin Seel philosophisch bis politisch nach dem menschlichen Wohlergehen befragt.
VERANSTALTUNGSTIPPS
Do., 11.09., 09.10., 13.11., 11.12.2025, 19:00–21:00 Uhr
Das Philosophische Café
Das beliebte Format mit Markus Melchers
Markus Melchers
7,00 € je Termin | Nr. 6240F ff.
Di., 25.11.2025, 19:00–21:00 Uhr
Textseminar: Martin Seel
Wohlergehen – über einen Grundbegriff der praktischen Philosophie
Markus Melchers
10,00 € | Nr. 6244F

 Sexualisierte Gewalt in der Kirche überwinden: welche Gottesdienste wollen wir feiern?
Sexualisierte Gewalt in der Kirche überwinden: welche Gottesdienste wollen wir feiern?


 Diesmal ist unsere Nachhaltigkeitsseite inspiriert vom Gebets- und Liederbuch für Klimaaktionen von GreenFaith. GreenFaith ist eine globale multireligiöse Klimabewegung, die Menschen verschiedenen religiösen und spirituellen Backgrounds zusammenbringt, um sich gemeinsam um Klimagerechtigkeit zu bemühen.
Diesmal ist unsere Nachhaltigkeitsseite inspiriert vom Gebets- und Liederbuch für Klimaaktionen von GreenFaith. GreenFaith ist eine globale multireligiöse Klimabewegung, die Menschen verschiedenen religiösen und spirituellen Backgrounds zusammenbringt, um sich gemeinsam um Klimagerechtigkeit zu bemühen.

 Im Gestalten steckt viel: Aktivität. Optimismus, etwas umsetzen, schaffen oder entstehen lassen zu können. Aber auch ein Lernen in Bezug auf das WIE des Gestaltens, etwa, wenn es um neue Techniken, Perspektiven, Möglichkeitsräume oder Herangehensweisen geht. Durch die Einbettung von LEBEN zwischen ZUSAMMEN und GESTALTEN werden schließlich Möglichkeiten zum neuen Arrangement der Worte wie ZUSAMMENLEBEN GESTALTEN erkennbar.
Im Gestalten steckt viel: Aktivität. Optimismus, etwas umsetzen, schaffen oder entstehen lassen zu können. Aber auch ein Lernen in Bezug auf das WIE des Gestaltens, etwa, wenn es um neue Techniken, Perspektiven, Möglichkeitsräume oder Herangehensweisen geht. Durch die Einbettung von LEBEN zwischen ZUSAMMEN und GESTALTEN werden schließlich Möglichkeiten zum neuen Arrangement der Worte wie ZUSAMMENLEBEN GESTALTEN erkennbar.
 „Das ist wahrscheinlich einer der schönsten Orte, an denen ich bisher gelesen habe“, leitete Pourviseh ein. Um alle Besuchenden in sein Buch mit hineinnehmen zu können, klärte er vorweg die Grundlagen der Migration über das zentrale Mittelmeer. Rasch wurde deutlich, dass hier nicht ein Referent routiniert ein x-mal erprobtes Konzept abspulte, sondern ein Zeuge des Geschehens, ein Beteiligter einfühlsam wie engagiert die Anwesenden mit Ereignissen und Zuständen konfrontierte, die man gerade auch eingedenk von EU-Entscheidungen und des Vorgehens vieler europäischer Staaten als unfassbar bezeichnen darf.
„Das ist wahrscheinlich einer der schönsten Orte, an denen ich bisher gelesen habe“, leitete Pourviseh ein. Um alle Besuchenden in sein Buch mit hineinnehmen zu können, klärte er vorweg die Grundlagen der Migration über das zentrale Mittelmeer. Rasch wurde deutlich, dass hier nicht ein Referent routiniert ein x-mal erprobtes Konzept abspulte, sondern ein Zeuge des Geschehens, ein Beteiligter einfühlsam wie engagiert die Anwesenden mit Ereignissen und Zuständen konfrontierte, die man gerade auch eingedenk von EU-Entscheidungen und des Vorgehens vieler europäischer Staaten als unfassbar bezeichnen darf.